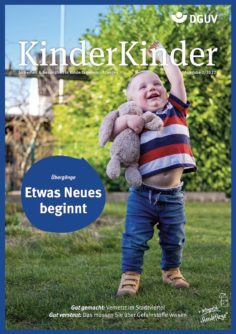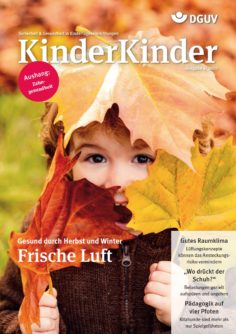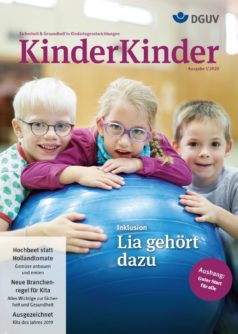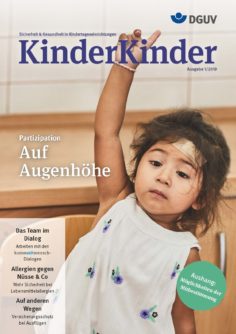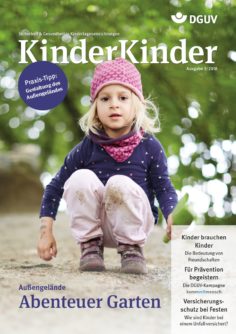Ruhe- und Rückzugsorte für Kinder – ein paar Worte zur Sicherheit
In den Ruhe- und Rückzugsbereichen – etwa auch Snoezelräumen – sollten Sie vor allem älteren Kindern die Gelegenheit geben, sich zurückzuziehen. Auch sie müssen sicher gestaltet sein.
Die Ruhe- und Rückzugsbereiche können sich außerhalb oder innerhalb eines Gruppenraumes befinden, beispielsweise als Matratzenlandschaft, Hochebenen mit Kuschelecken, Schlafhöhle oder -podeste. Durch Regale, halbhohe Schränke oder Trennwände mit ausreichender Standfestigkeit können Sie diese Bereiche abtrennen.
Da in solchen Ruhebereichen nicht alle Gefahren offensichtlich sind, gilt es, im Rahmen der Gefährdungsbeurteilung insbesondere auf versteckte Gefahren und Risiken wie Fangstellen und Kleinteile zu achten.
Um zu vermeiden, dass sich Kinder strangulieren, sollten hinsichtlich möglicher Fangstellen die Vorgaben der Spielplatzgerätenorm DIN EN 1176 angewendet werden Darüber hinaus gelten dieselben Sicherheitsanforderungen wie bei Schlafräumen.
Stellen Sie sicher, dass Kissen, Matratzen etc. regelmäßig gewaschen und gesäubert werden. Schreiben Sie dies in den einrichtungsspezifischen Hygieneplan. Hinweise und Vorgaben zur Hygiene erhalten Sie bei den Gesundheitsämtern.
Auf jeden Fall müssen Sie gegebenenfalls länderspezifische Vorschriften beachten.
Aus: Branche Kindertageseinrichtungen, DGUV Regel 102-602 (https://repos.rms2cdn.de/files/kita/102-602.pdf)
Checkliste: Planung des Raumes
Es kann hilfreich sein, sich das Raumkonzept und -nutzung vorher aufzuzeichnen und dabei stets die Bedürfnisse der zu Betreuenden im Blick zu haben. Folgende Überlegungen und Hinweise helfen:
- Ist der Raum barrierefrei zugänglich?
- Soll der Raum im Sitzen, Liegen oder für bewegte Angebote genutzt werden?
- Snoezelräume sollten von störenden Umwelteinflüssen getrennt sein und nicht in Eingangs- oder Durchgangsbereichen liegen.
- Es sollten, wenn möglich, Schallschutz-Türen vorhanden sein.
- Bestmöglich gibt es eine Trittschalldämmung sowie Verdunklungsmöglichkeiten (Fensterfolien, lichtdichte Rollos oder Vorhänge).
- Achten Sie auf kindersichere Steckdosen und Verkabelungen.
- Die Raumtemperatur und die Lüftung sollten regulierbar sein.
- Die räumliche Gestaltung sollte anpassungsfähig und modellierbar sein.