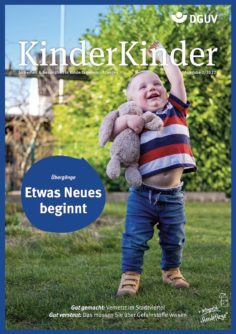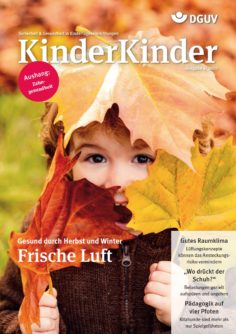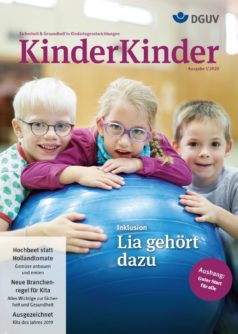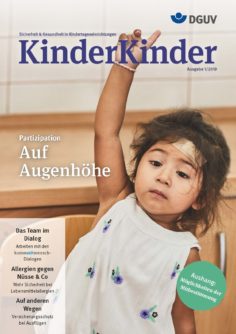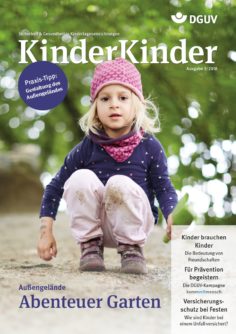Inwiefern hängen Bewegung und Sprachentwicklung zusammen?
Ein Kind redet, plappert, singt und erzählt ganz von allein
– genauso, wie es rennt, hüpft, über Gräben springt und
auf Mauern balanciert. Dennoch kann man die Entwicklung
von Sprache und Bewegung nicht einfach sich selbst überlassen
und davon ausgehen, dass das Kind sich „schon
irgendwie normal“ entwickeln wird. Zu viele Kinder gibt
es nämlich, deren Spracherwerb aus unterschiedlichen
Gründen nicht problemlos verläuft, die auch in der Motorik
Schwierigkeiten haben. Sprache und Motorik entwickeln
sich in der Auseinandersetzung mit der Umwelt. Es bedarf
also einer anregenden Umgebung, die sowohl Impulse für
die motorische Entwicklung als auch für die Unterstützung
des Spracherwerbs gibt und idealerweise beide Bildungsbereiche
miteinander verknüpft.
Wie können pädagogische Fachkräfte Bewegungsanlässe
zur Sprachförderung nutzen?
Ich greife einmal die Bereiche Wortschatz und Wortbedeutung
heraus:
Kinder erfahren in Bewegungsspielen, was „auf“, „unter“,
„hinter“ oder „vor“ dem Tisch bedeutet. Oder sie üben
sich in der Begriffsbildung: Was ist rund, was ist eckig,
hart, weich? Durch das Anfassen, Ertasten, Ergreifen und
Benennen werden taktil wahrgenommene Eigenschaften
der Objekte zu Begriffen. In Bewegungsspielsituationen
werden auch Begriffskategorien gebildet: Wie kann man
sich fortbewegen? Watscheln, schleichen, rennen, stolzieren
… So erweitern Bewegungserfahrungen den Wortschatz,
gleichzeitig lernen die Kinder, was die Begriffe bedeuten
und worin sie sich unterscheiden.
Gibt es bestimmte Bewegungsformen oder -spiele, die für die Sprachförderung besonders geeignet sind?
Sprechanlässe ergeben sich nahezu überall: beim gemeinsamen
Spielen, beim Bauen und Konstruieren, beim Aushandeln
von Rollen und Regeln. Es kommt vor allem darauf
an, dass die pädagogische Fachkraft ganz bewusst eine
sprachförderliche Haltung einnimmt, also zum Beispiel die
eigenen Handlungen, aber auch die der Kinder sprachlich
begleitet: „Ich nehme mir den großen Ball.“ „Du hast das
Tor ganz genau mit dem Ball getroffen.“ Oder indem sie die
Handlungsschritte sprachlich weiterführt: „Guck mal, dein
Luftballon fliegt hoch in die Luft – jetzt hast du ihn mit dem
Finger angetippt und er fliegt noch höher.“
Warum ist es für Kinder, die Deutsch als zweite Sprache erwerben, besonders wichtig, Bewegung einzubeziehen?
Bei Kindern, die nicht die deutsche Sprache sprechen, ist es für die pädagogische Fachkraft besonders wichtig, zunächst einmal einen Zugang zum Kind zu erhalten. Oft wirken nonverbale Spielanlässe, Spiele mit Material und interessanten Objekten als „Eisbrecher“. So fordert der Ball zunächst einmal zum Handeln auf, erst dann zum Sprechen: Man kann ihn rollen, werfen, fangen – Bewegungsverben werden im Handeln erfahren und geübt. Grammatikalische Regeln werden nebenbei aufgenommen und prägen sich ein: Ich werfe den Ball, du wirfst den Ball zurück, der Ball wird gerollt – aktive und passive Formen, Verbflexionen und Artikelgebrauch. So schwierig die deutsche Grammatik auch scheint, beim Spiel mit dem Ball wird sie fast „nebenbei“ erfahren.
Spielt Bewegung eigentlich auch eine Rolle für den Schriftspracherwerb?
Das Schreibenlernen ist eng verbunden mit feinmotorischen Prozessen, aber auch mit der Körperwahrnehmung und der Raumwahrnehmung. Die Bewegungen der Hand und der Finger müssen gesteuert und koordiniert werden, hierzu bedarf es einer differenzierten taktilen und kinästhetischen Wahrnehmung. Wahrnehmung und Bewegung sind also auch für den Schriftspracherwerb von Bedeutung.
Die Fragen stellte Holger Schmidt