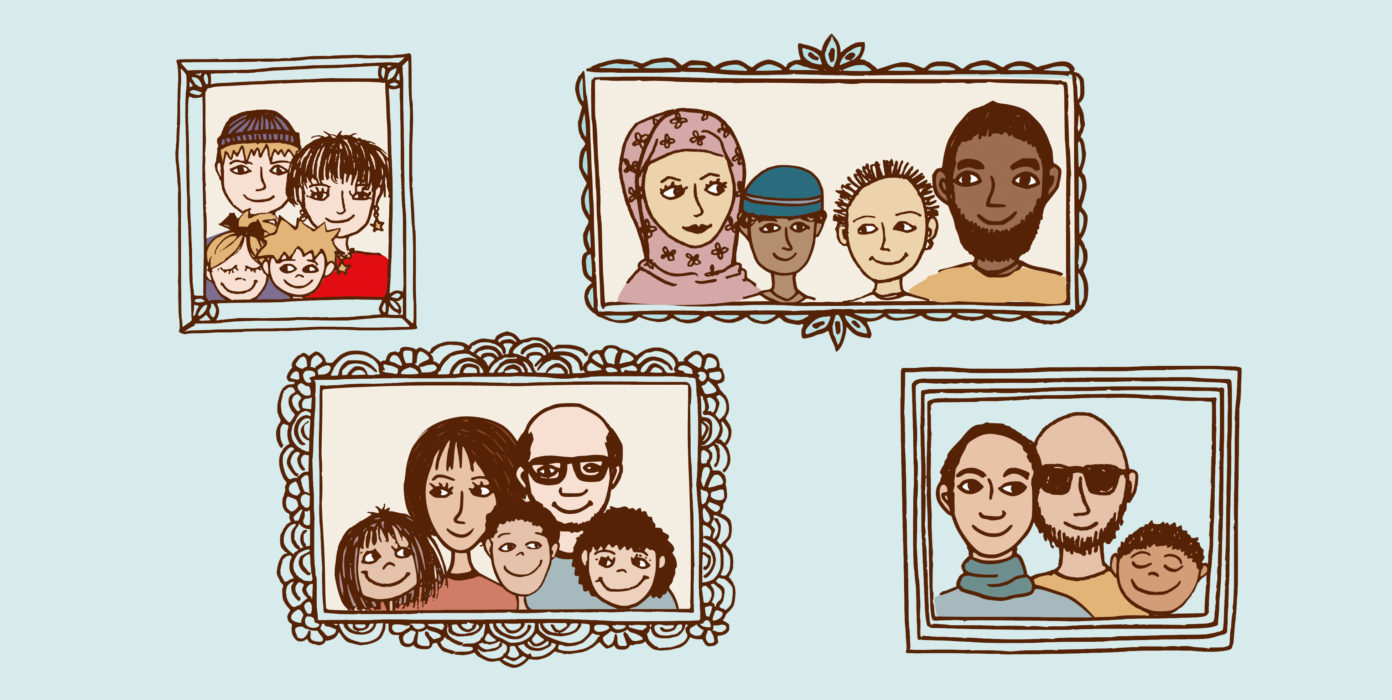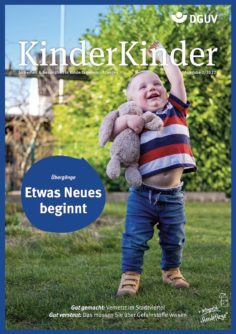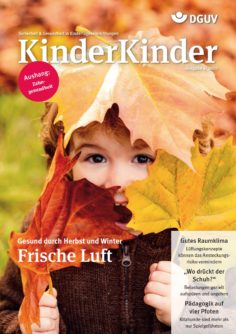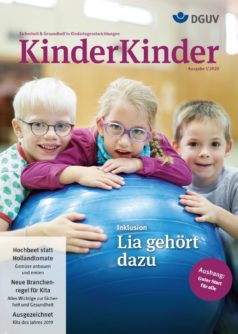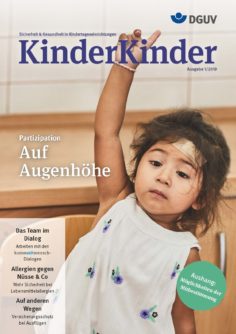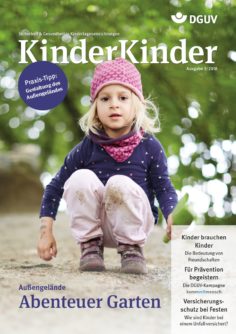Was macht eine gute Zusammenarbeit mit den Eltern aus?
Eine der wichtigsten Voraussetzungen ist gutes Fachwissen zur heutigen Vielfalt von Elternschaft. Denn es gibt zahlreiche unterschiedliche Familienformen, unterschiedliche Lebenslagen, unterschiedliche Lebenswelten, in denen Kinder aufwachsen. Damit einher geht natürlich eine große Vielfalt, was den Familienalltag der Kinder betrifft, die eine Kita besuchen. Es gibt außerdem die unterschiedlichsten Erziehungsvorstellungen. Stammt eine Familie etwa ursprünglich aus einer autoritären Gesellschaft, ist für die Eltern eine freiheitliche, demokratische Erziehung zunächst ungewohnt, dann brauchen sie eine Erklärung bezogen auf das Erziehungs- und Bildungsverständnis in der Kita. Für eine gute Zusammenarbeit mit Eltern muss also der jeweilige Hintergrund einer Familie berücksichtigt werden.
Müssen Fachkräfte demnach ihre Konzepte zur Elternkooperation und Erwartungen an die Rolle der Eltern mit der gegebenen Realität abgleichen?
Richtig. Es gibt nicht mehr „die Eltern“. Natürlich darf eine Kita dennoch ganz unabhängig vom Hintergrund der Eltern erwarten, dass diese den Fachkräften zutrauen, zum Wohl des Kindes zu agieren, und dass sie ihre Professionalität anerkennen. Diese Erwartungshaltung müssen Einrichtungen aber auch darstellen und das Ver-trauensverhältnis zwischen den Eltern und den Fachkräften aktiv gestalten. Denn beide – Eltern und Fachkräfte – eint ja ein gemeinsames Interesse: Sie wollen, dass es den Kindern gut geht.
Was können Eltern im Gegenzug von Fachkräften erwarten?
Sie können erwarten, dass die Kita in der Lage ist, ihr professionelles Handeln zu rechtfertigen und darzustellen, gerade auch, wenn es um Konfliktthemen geht, wie unterschiedliche Vorstellungen zur Vorbereitung auf die Schule, das kindliche Spiel oder die Fürsorge – Stichpunkt Beteiligung und Kinderrechte. Eine Fachkraft muss den Eltern gegenüber nachvollziehbar erklären können, warum sie es dem Fünfjährigen zutraut zu beurteilen, ob er eine Jacke anziehen möchte oder nicht.
Das heißt, der Schlüssel ist Kommunikation und damit die Arbeit so transparent zu machen wie möglich?
Ganz genau, darauf kommt es an. Transparenz, gepaart mit einer feinfühligen Kommunikation seitens der Fachkräfte.
Manchmal empfinden Kitabeschäftigte es als anstrengend, diese Transparenz herzustellen und im Gespräch zu bleiben. Worin liegt der Gewinn für die Kita, es doch zu tun?
Fachkräfte suchen sich in erster Linie den Beruf aus, um mit Kindern zu arbeiten. Aber: Es gibt die Kinder gerade in den ersten sechs Lebensjahren nicht ohne ihre Eltern bzw. primäre Bezugspersonen. Wenn ich als Fachkraft die Eltern für mich gewinne, ihnen die Tür öffne, eine Willkommenskultur pflege, sie beteilige und ihnen Mitgestaltungsmöglichkeiten gebe, dann schaffe ich ein Vertrauensverhältnis und zeige den Eltern, dass sie hier gern gesehen sind. Dafür kann die Einrichtung informelle Begegnungspunkte einrichten wie ein kleines Café, einen Stehtisch mit Getränken, eine monatliche Tauschbörse für Bilderbücher. Das Schlimmste, was den Fachkräften passieren kann, ist, dass die Eltern das Gefühl haben, ein Störfaktor zu sein. In einer solchen Kita möchte man sein Kind nicht gern lassen.
Wie viel Eltern-Mitbestimmung und -beteiligung ist sinnvoll und machbar?
Einrichtungen brauchen eine klare Gestaltung der Elternbeteiligung, aber die kann von Kita zu Kita sehr unterschiedlich sein. Die Einrichtung sollte ausloten, welchen Spielraum sie konkret mit „ihren Eltern“ hat, was sie sich und den Eltern zutraut, in welchem Maß und in welchen Fragen sie diese beteiligt. Ein Beispiel wäre, Eltern dabei einzubinden, was die Gestaltung und Themen der Elternabende angeht. Auch bei konzeptionellen Angelegenheiten kann die Elternschaft angehört und deren Argumente berücksichtigt werden. Das Aushandeln von Interessen der Eltern und der Einrichtung ist wichtig. Wenn Eltern mit der groben Linie der Pädagogik einverstanden sind und sie gutheißen, dann profitieren die Kinder.
Es kommen oft die gleichen Eltern zu Wort – die ohnehin sehr engagierten, etablierten. Wie bezieht die Kita auch leisere, zurückhaltende Eltern mit ein?
Eine Möglichkeit wäre, die Elternabende oder -nachmittage anders zu gestalten. Man verständigt sich auf ein übergeordnetes Thema, bietet aber Thementische an, moderiert von einer Fachkraft. Da gibt es eine Vielzahl an alternativen Formaten. Ich finde, sie können nicht niedrigschwellig genug sein und müssen sich an den Bedürfnissen der Eltern orientieren. Auch dazu muss man im Gespräch bleiben.
Ist gute Elternzusammenarbeit langfristig planbar? Was, wenn etwa engagierte Eltern bzw. deren Kinder die Einrichtung verlassen und zum Beispiel plötzlich keine größeren gemeinsam organisierten Aktionen mehr stattfinden können?
Es wird nicht dauerhaft funktionieren, wenn sich Kitas darauf verlassen, dass immer engagierte Eltern da sein werden. Die Gruppe ist zu heterogen. Elternschaft hat sich viel zu sehr verändert. Einrichtungen müssen ein Konzept zur Elternkooperation haben, das die große Bandbreite der Eltern erreicht, und sollten auch die Vermittlung von Lebenspraxis darin verorten. Kinder sind heute immer früher und länger in Kitas. Alltagsbildung findet also vermehrt in den Einrichtungen statt. Kitas können Eltern hier gut unterstützen, vor allem, weil bei diesen immer häufiger Erziehungsunsicherheiten wahrzunehmen sind. Deshalb sollten die Institutionen dringend den Fokus stärker auf diesen Aspekt legen statt auf Event-Pädagogik. Natürlich braucht es noch gemeinsame Feste und Aktionen, aber vielleicht nicht riesige Ausflüge in den Zoo und den perfekten Martinsumzug.
Die Fragen stellte Stefanie Richter